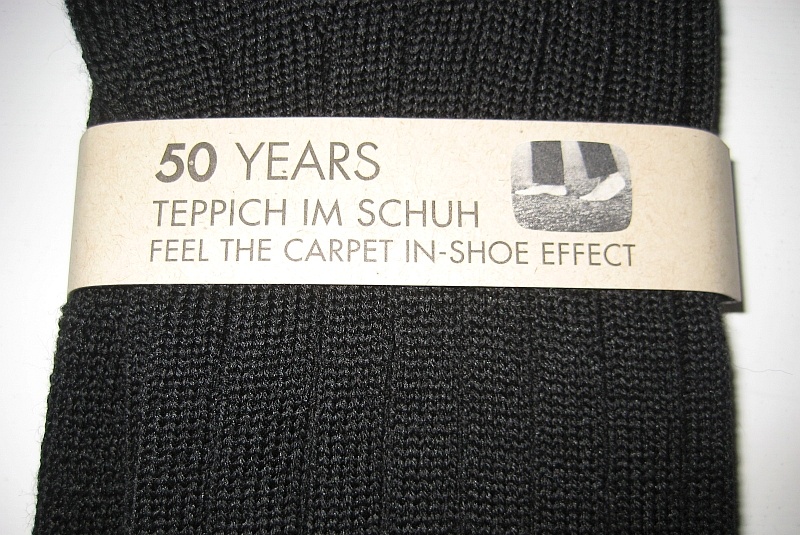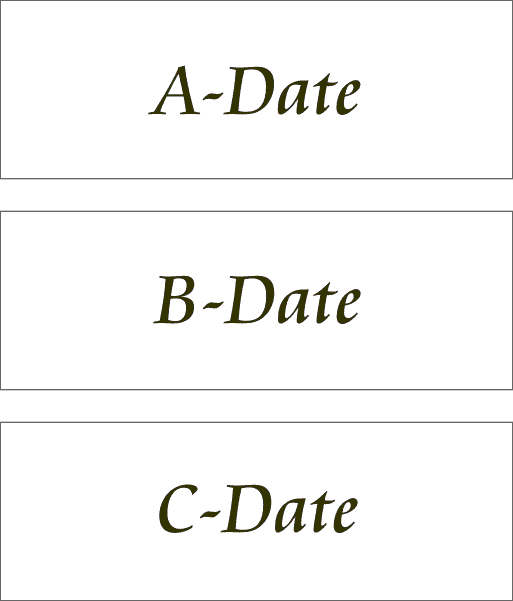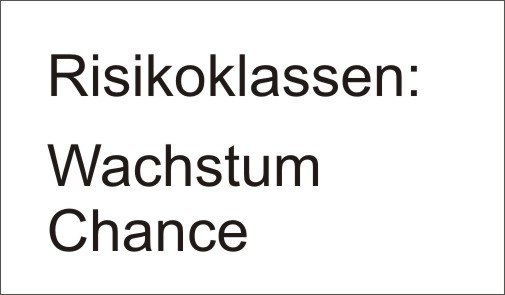Wie zu lesen war, ist „Stadt, Land, Fluss“ zwar eine Marke für Spiele, dennoch kann der Name auch von einem anderen Spieleanbieter verwendet werden. Wie kann das sein? Was sagt das Markenrecht? Der Reihe nach.
Ein App-Entwickler brachte vor einigen Monaten eine App mit dem Namen „Stadt, Land, Fluss“ auf den Markt, also in die online-Stores. Jeder kennt dieses Spiel noch aus der Kindheit, man braucht nur den Kopf, einen Zettel und einen Stift dazu, und natürlich (vor der App) mindestens zwei Spielwillige. Ein Spieleverlag wollte diesem nun untersagen, den Namen für das Spiel zu verwenden, weil er ja die Markenrechte an diesem Namen habe. Also an einem Namen, den jeder kennt und generisch verwendet. Wie kann der überhaupt als Marke geschützt sein und auf dieser Basis anderen dessen Verwendung untersagt werden?

Vor einigen Jahren brachte der Spieleverlag Schmidt ein solches Spiel als Fertigversion auf den Markt, wo man die Spalten nicht selber ziehen muss und die Kategorien schon eingetragen sind. Das Ganze wurde unter dem bekannten Namen „Stadt Land Fluss“ eingeführt. Und jetzt wird es interessant. Für den Namen „Stadt Land Fluss“ beantragte Schmidt eine Marke, die vom deutschen Markenamt auch gewährt wurde. Zu verstehen ist diese Entscheidung nur schwer, denn der eingetragene Begriff ist für solche Spiele ungefähr das, was Fruchtjoghurt für Fruchtjoghurt wäre. Also hochgradig generisch, beschreibend, und freihaltebedürftig. Egal, die Marke wurde eingetragen.
Nun wird es aber noch interessanter, denn der Sinn einer Marke ist ja nicht nur sie zu haben, sondern damit eigene Pfründe zu sichern und verteidigen zu können. Und hier zeigte sich, wieso solche schwachen Marken, selbst wenn sie eingetragen sind, eben keine Wundermittel sind. Das sind sie nämlich nur, solange der andere (der Angegriffene oder der angeblich Verletzende) Angst hat. Wenn er sich wehrt, kann die Sache ganz anders ausschauen (und ausgehen). Genau das ist hier passiert. Der Appentwickler nahm den Fehdehandschuh auf, ließ sich nicht einschüchtern, und so kam es nun zu der gerichtlichen Entscheidung, dass hier keine Markenverletzung vorliegt. Die Begründung ist einfach: Jeder darf den Begriff verwenden, um das Spiel damit zu beschreiben, und wenn er ihn nicht als Marke verwendet (hierüber kann man natürlich trefflich streiten, nur am Rande bemerkt).
Die ganze Sache ist sehr lehrreich, zeigt sie doch das sehr limitierte tatsächliche Abwehrpotential solch extrem beschreibender Marken, die dennoch Ziel der Begierde vieler Markenanmelder sind. Eine psychologische Abschreckungswirkung solcher Eintragungen mag aber im täglichen Leben durchaus existieren, und sie kann diese manchmal aus taktischen Gründen auch rechtfertigen.
PS: Im vorliegenden Fall wäre es sicher auch eine interessante Vorgehensweise gewesen, die Abwehr der Verletzung mit einem Antrag auf Löschung der Marke zu verknüpfen. Ob so etwas richtig und sinnvoll ist, kann aber nur ein spezialisierter Anwalt entscheiden.